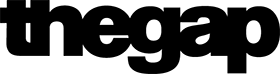Im dritten und letzten Eintrag des diesjährigen Ethnocineca-Tagebuchs geht es um Vergänglichkeit, aber auch um Neubeginne – gepaart mit einem Rückblick auf sieben wunderbare Festivaltage.

Wir sind mittlerweile am Ende des Ethnocineca-Festivals 2024 angelangt – Nach sieben Tagen, 13 Dokumentarfilmen, mehreren Workshops, unzähligen Gesprächen mit Filmschaffenden und viel zu viel Popcorn darf ich mich mit einem letzten Tagebucheintrag verabschieden. Doch zuerst: einige Highlights der letzten Festivaltage.
Kurz und wässrig
Es ist schon fast gruselig, wie schön das Töten eines Tieres dargestellt werden kann. In »Piblokto« lernen wir eine arktisch-indigene Gruppe kennen, die sich der Jagd von Meerestieren widmet. Mit poetischer Regelmäßigkeit schwappt das vom Blut gefärbte Meereswasser an das steinige Ufer, während eine Männergruppe daran arbeitet, einen eben getöteten Wal an Land zu ziehen. Dann ein Schnitt und wir beobachten Kinder, die mit toten Pinguinen spielen als wären sie Barbiepuppen, und Hunde, die das Blut eines aufgeschnittenen Walrosses lecken als wäre es Zuckerwasser. In einer spannenden (und etwas ekligen) Mischung aus Ethnographie, Kunstfilm und Universum-Doku beleuchten die Regisseur*innen Anastasia Shubina und Timofey Glinin die komplexe Wechselwirkung zwischen Mensch und Tier – mit Bildern, die (wortwörtlich) unter die Haut gehen.

Eingebettet ist dieser Kurzfilm in ein künstlerisches (wenn auch sehr experimentelles) Kurzfilmprogramm, das nicht nur die Schönheit unserer Natur, sondern auch ihre akute Bedrohung aufzeigen will. So begeben wir uns für den folgenden Kurzfilm »Enez« auf eine Insel, deren Zukunft längst verloren scheint: Langsam aber sicher engen die Wassermassen das Land ein und drohen, die Insel gänzlich zu verschlingen. In einem visuellen Pingpongspiel wechseln sich Wasseraufnahmen mit Szenen aus der Vergangenheit und Gegenwart ab, um zu zeigen, dass vom einst regen Treiben der Insel mittlerweile kaum etwas übriggeblieben ist. Der Film betont die Vergänglichkeit – und warnt vor Gefahren, die uns angesichts des Klimawandels bald alle betreffen könnten.
Das Schweigen Brechen

Erinnerungen weitergeben, die Stille brechen – das will Sarah Mallégol, die uns in ihrem Film »Kumva – Ce qui vient du silence« in ein gespaltenes Ruanda führt. Fast eine Million Menschen, ein Großteil davon Teil der Tutsi-Minderheit, kamen 1994 bei einem der größten Genozide der rezenten afrikanischen Geschichte ums Leben.
Der kollektive Schmerz dieses Ereignisses sitzt tief, gesprochen wird darüber aber kaum. »Familien werden von dieser Stille erdrückt«, beschreibt es Mallégol und schafft mit »Kumva« einen Raum, um genau dieses Schweigen zu brechen. Im Film kommen zwei Generationen zusammen, um endlich über das zu sprechen, was bisher nur im Subtext zu lesen war. »We thought we might never speak again«, so eine Überlebende des Genozids zu ihren Kindern. Doch nicht nur die Opfer kommen in dieser intimen Darstellung zu Wort. Ganz im Zeichen eines Perspektivenwechsels hören wir nämlich auch von Tätern, von grausamen Handlungen, und von ihren Familien, die mit Schuld und Stigma zu kämpfen haben. »Kumva« thematisiert sowohl das Sprechen als auch das Schweigen, sowohl das Verletzen als auch das Leiden. Es ist ein Film über Schmerz, der über Generationen hinweg erfahren wird, und ein Versuch, nach jahrelangem Schweigen endlich ein neues Kapitel aufzuschlagen.
»No condition is permanent«

»From good to bad, from bad to good« – unser nächster Protagonist fasst die Schicksalsschläge seines Lebens selbst am allerbesten zusammen. Mauro Bucci begleitet im Film »The Strong Man of Bureng« Essa aus Gambia bei seinem Versuch, in Europa Fuß zu fassen. Anfangs ist dieses riskante Unterfangen noch erfolgreich: Essa gelingt es, in Finnland ein Unternehmen aufzubauen und damit auch seiner Familie in Gambia unter die Arme zu greifen.
Auf einmal aber weltweites Chaos und Essas Erfolgsgeschichte beginnt zu bröckeln: Die Corona-Pandemie trifft nicht nur auf Europa, sondern auch auf Westafrika. Damit ist nicht nur Essas Existenz, sondern auch jene seiner Familie in Gambia bedroht. Wehmütig erinnert sich Essa an frühere Zeiten zurück, an Zeiten der Sorgenfreiheit und des Wohlstands. Was davon bleibt? Ein provisorisches Planenzelt am Rande der Stadt Rom, in dem Essa verzweifelt nach einem Ausweg aus seiner aktuellen Lage sucht. Bucci gelingt mit »The Strong Man of Bureng« ein Porträt eines Mannes im Guten und im Schlechten und er erinnert uns daran, dass einem auch der am härtesten erarbeitete Erfolg jederzeit entrissen werden kann.
Prämierter Perspektivenwechsel

Sowohl Bucci als auch Mallégol sind übrigens für einen der fünf Ethnocineca-Preise nominiert, die am Mittwoch, dem letzten Tag des Festivals, vergeben werden. Schon einige Zeit vor Beginn der Preisverleihung beginnen sich die Vorräume des Votivkinos langsam zu füllen. Es sind viele bekannte Gesichter, die an diesem Abend zu sehen sind. Auch die Filmemacher*innen selbst scheinen sich nach sechs intensiven Festivaltagen bereits miteinander angefreundet zu haben.
Nun aber ans Eingemachte: Wer nimmt sich dieses Jahr einen der heiß begehrten Awards mit nach Hause? Helin Çelik, dessen Meisterwerk »Anqa«bereits im zweiten Festivaleintrag vorkam, darf sich heute über den Austrian Documentary Award (ADA) freuen. Und auch ein weiterer Film aus diesem Eintrag wird gekürt: Mehran Tamadon darf für sein Sozialexperiment »Mon Pire Ennemi« den International Documentary Award (IDA) mit nach Hause nehmen.
Der beste ethnographische Film, so jedenfalls die Jury, war dieses Jahr »Adieu Sauvage« von Sergio Guataquira – für seine sensible autoethnographische Aufarbeitung gibt es eine Auszeichnung in deb Preis für Excellence in Visual Anthropology (EVA). Doch nicht nur Langfilme, sondern auch Kurzfilmbeiträge werden prämiert. So etwa Zsófia Paczolays »Budapest Silo«, in dem die Lebensrealität eines gewöhnlichen Mannes mit einem außergewöhnlichen Beruf aufgezeigt wird – mit einer audiovisuellen Gestaltung, die Gänsehaut verursacht. Und auch Marie Alice Falys Beitrag »Entre Les Autres«, die intime Geschichte einer Selbstfindung, wird mit dem Student Short Award der Ethnocineca (kurz ESSA) ausgezeichnet.
»Re-Rendering Perspectives« war das Motto der diesjährigen Ethnocineca und nach sieben Festivaltagen und knapp 50 Filmen lässt sich wohl kaum mehr abstreiten, dass sie diesem gerecht geworden ist. Umso mehr freuen wir uns also aufs nächste Jahr und auf noch mehr neue Sichtweisen – ein Perspektivenwechsel tut doch immer gut, nicht wahr?
Das Festival Ethnocineca zeigte von 16. bis 22. Mai 2024 internationalen ethnografischen Dokumentarfilm im Votiv Kino sowie im De France.
Dieser Artikel entstand im Rahmen eines Schreibstipendiums, das die Ethnocineca gemeinsam mit The Gap vergeben hat. Die gesammelten Einträge in unser Ethnocineca-Festivaltagebuch findet ihr hier.