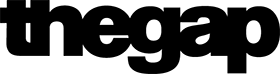Mittlerweile sind wir mitten im Geschehen des Ethnocineca-Festivals 2024 angekommen. Diesmal werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und auf Filme, die unter die Haut gehen.

Ein Filmfestival zu planen: Keine leichte Arbeit, wie mir die Festivalleitung Marie-Christine Hartig erzählt. Kein Wunder, denn um bei der Ethnocineca eine schmackhafte Auswahl an Dokumentarfilmen präsentieren zu können, braucht es eben auch einiges an Vorarbeit. Die »Verkostung« der Filmbeiträge ist ausführlich und beginnt schon knapp ein Jahr im Voraus: Kaum ist ein Festival also vorbei, geht es auch schon wieder los mit der Vorbereitung für das kommende Jahr. In einem kollaborativen Prozess werden die einzelnen Filmeinreichungen bewertet, aussortiert und in ein ansprechendes Rahmenprogramm eingebettet. Und das Ergebnis dieses Prozesses? Kann sich sehen lassen.
Fragmente eines Traumas

Nach einem gelungenen Auftakt sind wir mittlerweile mitten im Geschehen des diesjährigen Ethnocineca-Festivals angekommen und bekommen auch diesmal eine große Bandbreite an Filmprojekten aus aller Welt zu sehen. Ein Paradebeispiel dafür liefert uns etwa Filmemacherin Helin Çelik und begibt sich für ihren Dokumentarfilm »Anqa« nach Jordanien. In Fragmenten erzählen ihre Protagonistinnen von Folter, Vergewaltigung, Stigmatisierung und Isolierung. Von unbegreifbarem Leid also, das viel zu oft unausgesprochen bleibt.
Die Geschichten bleiben unvollendet, und auch die visuelle Darstellung ist brüchig. Mit Absicht, wie Çelik im darauffolgenden Gespräch erklärt. Der Film, ein Herzensprojekt der jungen Regisseurin, stellt sich nämlich gar nicht erst den Anspruch, vollständig zu sein. Stattdessen dominieren die Fragmente – und das auf narrativer, visueller und symbolischer Ebene. Çelik gelingt mit »Anqa« eine intime und poetische Darstellung dreier Frauen, die viel mehr sind als das Leid, das sie erfahren haben. So betont etwa eine Protagonistin: »Ich bin kein Überbleibsel. Ich existiere.«
Fiktive Realität oder reale Fiktion?

Eine komplette 180-Grad-Wende erwartet uns gleich im Anschluss an Çeliks Beitrag mit »Knit’s Island«. Die zentrale Frage des Films: Können Realität und Fiktion heutzutage überhaupt noch getrennt werden? Um eine Antwort darauf zu finden verbringen drei französische Filmemacher 963 Stunden in einer virtuellen Welt, in der scheinbar alles erlaubt ist. Als Avatare innerhalb dieses digitalen »Spielplatzes« versuchen sie, mehr über die eigentlich anonymen Spieler*innen und die Gründe ihrer Realitätsflucht zu erfahren.
Schon bald verschwimmen die Grenzen und es wird vor allem eines ersichtlich: Fiktion und Realität liegen oftmals näher beieinander, als man glauben würde. »Knit’s Island« ist ein hochaktueller und wertvoller (wenngleich etwas absurder) Beitrag, der eine äußerst beunruhigende Frage aufwirft: Was hält uns noch im echten Leben, wenn uns die virtuelle Welt schon so viel bieten kann?
»This dam will kill people«

Etwas konventioneller geht die Anthropologin Emily Hong vor und schafft mit »Above and Below the Ground« einen klassisch ethnographischen Film. Über Jahre hinweg begleitet sie die Kachin, eine christlich-indigene Gruppe in Myanmar, in ihrem Kampf gegen einen Damm, dessen Bau nicht nur die Umwelt, sondern auch ihre gesamte Lebensweise beeinflussen würde.
Erzählt wird diese Geschichte nicht von Hong, sondern von den Betroffenen selbst – ein großes Anliegen der koreanisch-amerikanischen Anthropologin, die mit ihrer Arbeit ein Gegennarrativ zu bisherigen Darstellungen schaffen möchte. Hong kritisiert nicht nur den westlich-dominierten Umweltschutz, sondern auch das koloniale Erbe der Anthropologie – ihre Forderung: eine »Dekolonisierung des ethnographischen Films«.
»This dam will kill people«, warnen die Aktivist*innen in Hongs Film, die sich unerbittlich gegen das Bauprojekt engagieren, dabei jedoch mit Repressalien, Vertreibung und Unterdrückung zu kämpfen haben. Schnell wird klar: Hier geht es um weit mehr als nur Umweltschutz. »Above and Below the Ground« ist die Geschichte einer Bewegung, die nicht nur die Umwelt, sondern auch eine ganze Kultur zu bewahren versucht.
Entblößt
Szenenwechsel. Auf allen Vieren kniet Regisseur Mehrad Tamadon am Boden, hechelt, zittert vor Kälte, während das Wasser von seinem Körper auf den Badezimmerboden tropft. Nur eine weiße Unterhose trennt den iranischen Filmemacher vor der völligen Entblößung, seine restliche Kleidung musste er schon längst ausziehen. Über ihn gebeugt, gänzlich bekleidet, den Duschkopf in der Hand: die Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi. Sie nimmt in diesem Sozialexperiment die Rolle einer Agentin des iranischen Regimes ein, die Tamadon als Dissidenten verhören und foltern soll. In »Mon Pire Ennemi« (Deutsch: »Mein größter Feind«) beobachten wir ein Experiment, das beide Beteiligten an ihre Grenzen bringt. Folter, Erpressung, Demütigung: Tamadon will in seinem Film genau das greifbar machen, was sonst nur hinter geschlossenen Türen passiert. Und steht dabei auch noch selbst vor der Kamera.
Tamadon, der übrigens auch mit dem Film »Jaii Keh Khoda Nist« (auf Deutsch: »Dort, wo Gott nicht ist«) beim Festival vertreten ist, agiert in seinen Filmen nämlich nicht nur als Regisseur, sondern auch als Protagonist. »Outside and inside at the same time«, wie es der Exiliraner in seinem Workshop treffend beschreibt. In seinen Projekten will der Filmemacher vor allem jenen Perspektiven, Handlungen und Meinungen auf den Grund gehen, die uns am unverständlichsten erscheinen. Wie das gehen soll? Im Dialog, denn nur so können die Grenzen laut Tamadon überwunden werden. Mit »Mon Pire Ennemi« ist dem Filmemacher ein besonders feinfühliges und selbstreflexives Projekt mit ganz viel Gänsehautpotential gelungen – eine absolute Empfehlung.
Nach dem Abspann verlasse ich das Kino und muss, draußen angekommen, erst mal kräftig durchatmen. Leichte Kost sind diese Filme jedenfalls nicht. Mich haben sie aber trotzdem überzeugt – ob die Jury das auch so sieht, werden wir wohl erst bei der Preisverleihung am Mittwoch erfahren.
Das Festival Ethnocineca zeigt vom 16. bis 22. Mai 2024 internationalen ethnografischen Dokumentarfilm im Votiv Kino sowie im De France.
Dieser Artikel entstand im Rahmen eines Schreibstipendiums, das die Ethnocineca gemeinsam mit The Gap vergeben hat. Die gesammelten Einträge in unser Ethnocineca-Festivaltagebuch findet ihr hier.