Junge Menschen haben laut Statistik immer weniger Sex. Woran liegt die Zurückhaltung in Sachen körperlicher Intimität? Und ist das überhaupt zu beklagen? Von einer Generation, die es – zwischen Aufklärung und Überforderung – anders macht.
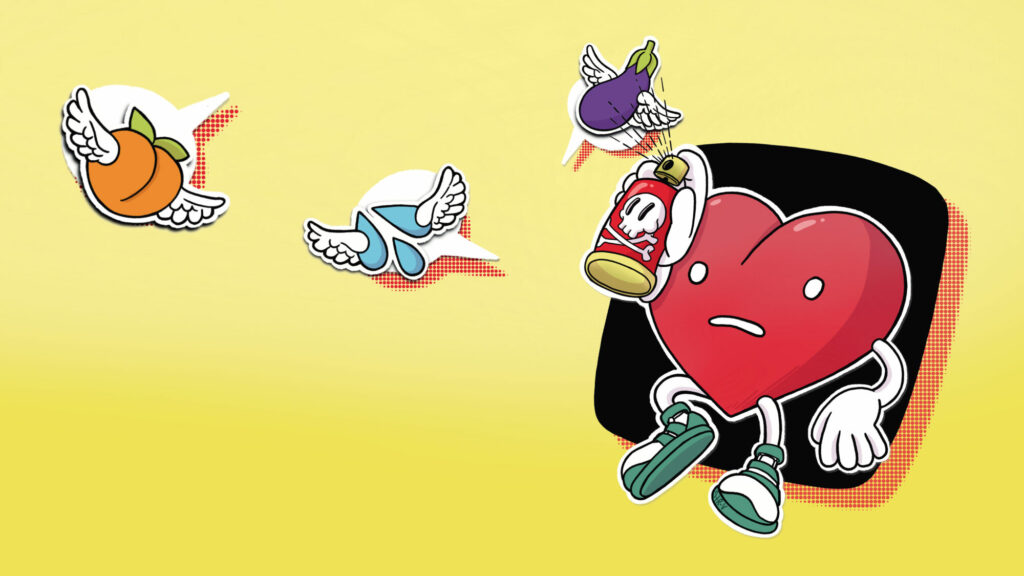
In meinen Teenagerjahren gab es in der Sportumkleide genau zwei Gesprächsthemen: wer schon Sex hat und mit wem. Bei Ersterem gab es eigentlich nur eine gültige Antwort. Denn der Druck war groß, und keine Erfahrungen vorweisen zu können, ein wohlgehütetes Geheimnis. Nun wird jene Generation, bei der ich zu den Älteren zähle, – natürlich vor allem im Internet – von manchen als »prüde Generation« oder »Puriteens« (eine Mischung aus »puritanisch« und »Teenager«) bezeichnet. Die Gen Z, also Menschen, die irgendwann zwischen 1995 und 2010 geboren sind, hat statistisch gesehen nämlich weniger Sex als ihre Eltern und Großeltern in deren Jugend. Und sie wünscht sich auch im Medienkonsum weniger Fokus auf intime Szenen und romantische Beziehungen. Warum ist das so? Hat die Jugend einfach keine Lust mehr auf Sex?
Ein zu oft erzähltes Märchen
Nach einer Studie der UCLA würden fast die Hälfte der jungen Erwachsenen weniger Sexszenen in Filmen und Serien befürworten. Noch mehr von ihnen bevorzugen einen vermehrten Fokus auf platonische Beziehungen zwischen Freund*innen. Für manche ein Grund zur Sorge. Denn: Sex sells! Und Sex on screen ist spätestens seit den 1990ern zentrales Element insbesondere von Filmen mit Zielgruppe Teens. Doch ist der Wunsch nach weniger körperlicher Intimität im Plot ein Wunsch nach Zensur, wie es die Bezeichnung »Puriteen« suggeriert? Oder werden Sexszenen schlicht überstrapaziert? Passen sie einfach nicht mehr zur Lebensrealität von Jugendlichen – und das nicht nur, weil diese heute weniger Sex haben? Es scheint in populären Produktionen nämlich derzeit nur wenige Optionen zu geben: Sex als Eroberung einer Frau à la James Bond. Oder als billiger Handlungstreiber, wenn der Beischlaf unnötige Konflikte auslöst. Oder dieselbe alte Hetero-Liebesgeschichte: Date. Sex. Happy End. Gääähn.
Dabei hat Sex im Film großes Potenzial: Für Heranwachsende ist es wichtig, ein möglichst vielfältiges Bild von Sexualität mitzubekommen, ob sie nun selbst Sex haben (möchten) oder nicht. Und gerade queere junge Menschen brauchen eine Repräsentation von Intimität, in der sie sich wiedererkennen können. Beispiele wie die Netflix-Serie »Sex Education« beweisen das Gegenteil einer prüden Generation: Jugendliche schauen durchaus gerne Geschichten, in denen Sex nicht nur gezeigt, sondern gar zum Hauptsujet gemacht wird. Immerhin ist »Sex Education« eine der meistgesehenen Serien der letzten Jahre – auch in Österreich. Aber hier ist Sex keine Nebensache, sondern ernstgenommenes Thema: mit allen Unsicherheiten, verschiedenen Identitäten, handlungsfähigen Charakteren und individuellen, manchmal auch merkwürdigen Körpern. Doch Repräsentationen von Sex sind dank Internet und Social Media nicht mehr nur auf Film und Fernsehen beschränkt. Wer einfach so Sex sehen will, muss nur die nächstgelegene Suchmaschine anwerfen.
Generation Online
Die Generation Z ist die erste, die mit Social Media aufgewachsen ist. Die etwas Älteren von uns hatten das Glück, eine internetfreie Kindheit zu genießen und trotzdem als »Digital Natives«, Menschen des digitalen Zeitalters, zu gelten: Wir können Oma erklären, wie man den WLAN-Router anschaltet und haben den Umgang mit neuen Technologien wie eine zweite Sprache ganz nebenbei gelernt. Die Digitalisierung sorgt für leichten Zugang zu Informationen, aber auch für eine überfordernde Menge an Texten und Bildern, die die Konsument*innen selbst filtern müssen. Für Heranwachsende findet die Aufklärung zumindest teilweise online statt. Diskurse rund um Sexualität, Gender und Feminismus wie beispielsweise #MeToo haben die Generation Z dabei geprägt. Gleichzeitig hat sie heute ohne Altersbeschränkungen so gut wie unbegrenzten Zugang zu Dating-Apps, Pornografie und (Fake) News. Eigentlich ist es verwunderlich, dass die Generation, die am besten vernetzt ist, die sein soll, die am wenigsten Sex von allen hat. Müsste der nächste One-Night-Stand nicht eigentlich nur einen Klick entfernt sein?
So einfach ist es nicht. Natürlich nutzen viele Menschen das Angebot. Doch die Jugend ist bei Weitem nicht so begeistert von Dating-Apps, wie ein paar Boomer-Kolumnist*innen vielleicht meinen. Seit Pandemiezeiten sinkt die Begeisterung sogar. Laut dem Marktforschungsunternehmen Savanta sind über 90 Prozent der befragten Zoomer frustriert von Dating-Apps. 21 Prozent der Studienteilnehmer*innen benutzen sie überhaupt nicht mehr. Und wen wundert es wirklich, dass auf Dopaminproduktion ausgelegte Apps nicht das erhoffte Ergebnis bringen. Oft wischt man, bis es keinen Spaß mehr macht oder das fünfte »Match« wieder nichts Interessantes zurückschreibt.
Auch die ständige Verfügbarkeit von Pornografie kann die Lust an Intimität mindern und für Verunsicherung sorgen. Jedoch sollte man dem Klischee der pornoabhängigen Jugend nicht allzu viel Raum geben. Das Risiko liege weniger im Inhalt als in falscher Verwendung, so Sexualtherapeutin und -pädagogin Cornelia Lindner: »Der Zugang zu Pornografie stellt aus meiner Sicht nicht das Problem dar, sondern die mangelnde Aufklärung und Medienkompetenz. Wer unterscheiden kann zwischen Realität und Fantasie – also Pornografie – und nicht ausschließlich Pornos ansieht, um Lust zu bekommen, wird auch nicht automatisch einen negativen Einfluss auf die eigene Sexualität riskieren.«

Achtet die Generation Z also einfach besser auf sich und sucht beim Ausleben ihrer Sexualität nach Qualität statt Quantität? Lindner zweifelt zunächst einmal grundsätzlich das »Problem« selbst an: »Ich würde bei solchen Statistiken immer zuallererst die Frage stellen, was mit Sex gemeint ist. Oftmals wird bei solchen Befragungen der Fokus auf Geschlechtsverkehr gelegt, weil das früher meistens das war, was als Sex galt. Dadurch werden viele sexuelle Handlungen ausgeblendet, ebenso wie queere Lebensrealitäten und Solosex. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Wichtigkeit von Geschlechtsverkehr gesunken ist und andere sexuelle Handlungen an Bedeutung gewonnen haben.«
Hier zeigen sich die positiven Aspekte von Aufklärungsarbeit und Informationsdichte der heutigen Zeit. Stigmatisierte Themen rund um Sexualität können freier diskutiert werden. Vielleicht schämt sich die Jugend einfach weniger, den eigenen Körper zu erforschen, »Nein« zu sagen und sich auf die Suche nach angenehmen Erfahrungen zu konzentrieren? Weniger Sex kann genauso gut weniger people pleasing, weniger bereute One-Night-Stands und weniger Druck bedeuten. Vielleicht haben junge Menschen gerade in der Pandemie auch Formen der Intimität schätzen gelernt, die nicht mit Sexualität verknüpft sein müssen. Das »Liebeshormon« Oxytocin wird genauso beim Streicheln, Umarmen oder bei Massagen ausgeschüttet. Selbst beim Kuscheln mit Haustieren produzieren wir es. Die Anspannung lässt nach, ein Gefühl der Geborgenheit breitet sich aus. Und es fehlt uns, wenn wir einsam sind.
Kann es noch Liebe sein?
Wenn junge Menschen sich nicht mehr so leicht in toxischen Rollenklischees verfangen, finden sie mit Sicherheit besser Zugang zu Intimität, die dann auch platonisch sein kann. Das Zentrum unseres Daseins muss schon lange nicht mehr die Ehe sein, menschliche Beziehungen können eine Vielzahl an Formen annehmen. Asexuelle Menschen leben etwa freiwillig ohne Sex, manche von ihnen in glücklichen romantischen Beziehungen, andere völlig ohne. Sie haben heute eine so große Sichtbarkeit wie nie zuvor. Ist es also wirklich verwunderlich, dass die Gen Z mehr Geschichten über tiefe Verbindungen und verschiedene Formen von Intimität sehen will, anstatt zum 100. Mal dasselbe Hetero-Märchen erzählt zu bekommen?
Eine Erklärung dafür, warum dieses Märchen von unserer Gesellschaft trotzdem noch immer so gerne erzählt wird, liefert der Kapitalismus. Die schwedische Comickünstlerin Liv Strömquist spricht in ihrem Buch »Ich fühl’s nicht«, mit Verweis auf die Soziologin Eva Illouz, von einer Kapitalisierung der Liebe und der Intimität. Sex wird damit zum Produkt und die Partner*innen werden zu Konsument*innen. Das erklärt auch, warum in den Medien so viele unwirkliche, gestählte Körper gezeigt werden: Es geht nicht ums Echt-Sein, sondern um Leistung. Und es geht um ein Ideal. Das steigert nicht unbedingt die Lust auf Sex, wenn man als verunsicherter Teenager zusieht.

Wer Sex als Produkt sieht, wird überkritisch und wählerisch. Dabei geht es nicht darum, dass niemand Ansprüche und Wünsche haben darf. Doch die Person, mit der die Intimität stattfinden soll, wird in diesem Prozess unwichtig. Stattdessen rückt ein abstrahiertes Bild von ihr in den Mittelpunkt: Kaum habe ich eine Person abgelehnt, weil sie zum Beispiel nicht dem gleichen Hobby nachgeht, kriege ich schon eine neue Person geliefert, die ich anhand meiner selbstaufgestellten Kriterien bewerten kann. Swipe, swipe, swipe. Menschen werden ersetzbar. Man schaut sich also die potenziellen Partner*innen an, als sei man beim Shoppen und nicht bei einem Date. Strömquist schreibt dazu: »In diesem Sinne wirkt die rationale Entscheidungsmethode der Entstehung des Gefühls ›sich zu verlieben‹ sogar entgegen – da es die intuitive Bewertung stört und einem Verhalten Vorschub leistet, als sei man Konsument*in im Supermarkt.«
Der Philosoph Byung-Chul Han führt es in seinem Buch »Agonie des Eros« (was für ein Titel!) sogar noch drastischer aus. Natürlich gehört nicht immer ein Verlieben oder eine tiefe Zuneigung zum Sex. Manche haben ihn und sehen sich nie wieder. Das ist auch okay. Han vermisst aber etwas, das sich nicht nur im Bett bemerkbar macht: In einer narzisstisch geprägten Gesellschaft, also einer ich-fokussierten empathielosen Selfie-Welt, verschwindet das Gegenüber. Und damit auch der Eros, die erotische Hingabe. Echte Nähe ist schwer möglich, wenn man vor lauter Ich-Fokus andere gar nicht empathisch wahrnehmen kann. Und das Anders-Sein erst überhaupt nicht zulassen möchte. Han schreibt: »Der Eros gilt dem ›Anderen‹ im empathischen Sinne, der sich ins Regime des Ich nicht einholen lässt. In der Hölle des Gleichen, der die heutige Gesellschaft immer mehr ähnelt, gibt es daher keine ›erotische Erfahrung‹.«
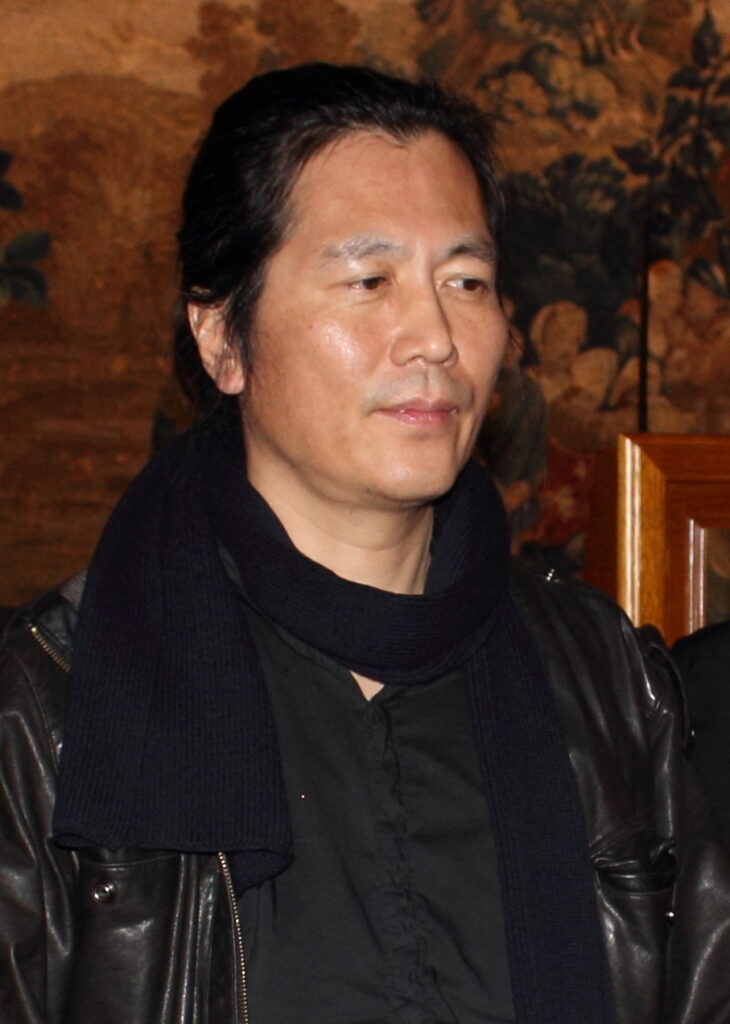
Ist das Problem der Generation Z also ein Paradoxon? Einerseits wird ihnen suggeriert, unter allen angezeigten Menschen die Auswahl zu haben, und gleichzeitig wird ihr Fokus immer wieder zurück auf sie selbst gelenkt, bis das Umfeld zu einer Nebensache verschwimmt. Wenn mir Social Media täglich zeigt, wie schön das Leben, der Körper anderer aussieht, führt das zu einem ständigen Vergleichen. Und gemeinsamer Sex funktioniert nur, wenn man einander dabei wahrnehmen kann. Wie steht es also um das Selbstbild der Generation Z? Haben ihre Vertreter*innen überhaupt die Kapazitäten, um sich, wie Han es formuliert, einem Gegenüber wirklich hingeben zu können?
Das Leid der Jugend
Laut dem Austrian Health Report 2023 geht es jungen Menschen in Österreich so schlecht wie noch nie. Nur etwas mehr als die Hälfte der Gen Z gibt in der Befragung an, sich gut zu fühlen. Junge Menschen haben überdurchschnittlich häufig Erschöpfungssymptome, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. Die Hälfte von ihnen ist unzufrieden mit dem eigenen Körper, und sie sind – mehr noch als die Generation der Millennials vor ihnen – häufig einsam. Wie mentale Gesundheit und Sexualität verknüpft sind, beschreibt auch Cornelia Lindner: »Wenn der eigene Selbstwert leidet, hat das tatsächlichen Einfluss auf das Lustempfinden.«
Nicht zuletzt hat auch die Pandemie vielen jungen Menschen den Kontakt zu anderen schwer gemacht. Zwei Jahre Studium von zu Hause aus zu absolvieren, wichtige Teenagerjahre im eigenen Zimmer zu verbringen, hat seine Spuren hinterlassen. Erhebungen attestieren der Gen Z ein geringes Risikoverhalten, wozu auch die Häufigkeit von Sex zählt. Sie trinken weniger Alkohol als andere Generationen und wohnen, dank überhitztem Immobilienmarkt und ausufernder Inflation, länger zu Hause. Dass ein schlechtes Selbstwertgefühl und Einsamkeit auch zu einer Radikalisierung führen können, zeigt der steigende Zulauf, den »Incels« und misogyne Influencer erfahren. Der Begriff »Incel« leitet sich von »involuntary celibate«, also unfreiwillig enthaltsam, ab. Diese Männer deuten ihre erfahrene (oder ausgedachte) Ablehnung durch (potenzielle) Partnerinnen in Menschenhass und Gewalt um. Sie vernetzen sich über soziale Medien und sind dank zunehmender Verunsicherung zahlreicher denn je.
Umgekehrt gibt es in Südkorea seit einigen Jahren eine feministische Bewegung, die sich absichtlich dem Sex verweigert. Unter dem Namen 4B (übersetzbar als »Vier Neins«) wehrt sie sich gegen die strikte Rollenverteilung zwischen »Mann« und »Frau« in ihrer Heimat. Die »Vier Neins« bezeichnen jene vier Aktivitäten, bei denen die jungen Frauen der Bewegung streiken und sich weigern ihnen mit Männern nachzugehen: Sex, Dating, Schwangerschaft und Eheschließung. Sie lehnen normierte Schönheitsideale und eine patriarchale Gesellschaft ab, in der sie sich unsicher und unfair behandelt fühlen. Denn wie überall sind auch in Südkorea Femizide, Revenge Porn und sexualisierte Übergriffe drängende Probleme. Nur, um es nicht zu vergessen: Auch in Österreich ist jede dritte Frau von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. Frauen, die sich dagegen wehren wollen, bleiben oft wenige Möglichkeiten. Und so haben sich die Südkoreanerinnen der 4B-Bewegung dazu entschlossen, ihre gesellschaftlichen Rollen vollkommen abzulehnen. Das Private bleibt weiterhin politisch.
Die Erfahrungen mit einem omnipräsenten Patriarchat haben auch einen Einfluss darauf, wie junge Menschen ihre Sexualität ausleben. Jegliche Form der Diskriminierung ist ein Hindernis dafür, sich frei entfalten zu können. Noch immer bedarf es eines Coming-outs, noch immer können sich nicht alle Liebenden treffen und zeigen, wie sie möchten. Die realistische Angst lauert uns im Nacken, wenn wir nach draußen gehen, und sie wird so schnell nicht verschwinden. Die Traumata, die Sicherheitsvorkehrungen und die Anzahl an Uber-Fahrten, um sicher nach Hause zu kommen, haben für mich wie für viele andere einen Schatten über das Ausleben von Sexualität und Dating gelegt, der bleibt. Das ist nichts, was die Generationen vor uns nicht kennen. Und dennoch: Jede neue Headline, die auf unserem Smartphone aufpoppt, füttert ein kollektives Bewusstsein, das uns daran erinnert, dass wir nicht sicher sind. Vor allem nicht in unserem intimsten Umfeld.
Was bleibt also vom Mythos der »prüden Generation«? Wenn ich jetzt an die Zeiten in der Sportumkleide zurückdenke, so war das ganze Gerede darüber, wer wie viel Sex hat, auch internalisierte Misogynie. Und verinnerlichte Scham, die Individuen in eine »Normalität« zwingen sollte. Dass das Thema Geschlechtsverkehr so zentral anmutet, um die eigene Identität, die eigene Wertigkeit zu definieren, ist eigentlich befremdlich. Sollte es nicht egal sein, wen wir auf welche Weise gut finden? Viel Sex ist nicht automatisch guter Sex. Und ein asexueller Mensch kann ein glückliches Leben und intime Beziehungen führen.
Neue alte Vorwürfe
Auch Cornelia Lindner sieht die Zukunft gelassen: »Ob die Gen Z also tatsächlich weniger Sex hat? Ich glaube, dass sie anderen, diverseren Sex hat und dass die Häufigkeit an Bedeutung verloren hat. Die Frage nach dem ›Wer bin ich? Und zu wem fühle ich mich hingezogen?‹ kann stressen, wenn Jugendliche nicht erfahren durften, dass beide Fragen immer nur im jetzigen Moment beantwortet werden können und dass sich sowohl Orientierung wie auch Identität ein Leben lang verändern.«
Die Gen Z hat in den letzten Jahren jenes große Los gezogen, dass jede neue Generation ereilt: Kritik und Vorurteile der vorhergehenden. Schon zur Zeit Platons beklagte man sich über die Jugend: Sie sei faul, ungehorsam und zu nichts zu gebrauchen. Ähnliches hört man auch über die Gen Z. Nicht nur prüde sollen wir sein, auch arbeitsscheu, handysüchtig und ängstlich. Dabei ist es immer eine einfache Lösung, die Jugend für Veränderungen verantwortlich zu machen und sie mit Vorurteilen zu belasten, statt sich zu fragen, in welcher Welt sie aufwachsen müssen. Ob junge Menschen viel oder wenig Sex haben, sollte nicht das Thema sein – das zu fragen, hat außerdem einen übergriffigen, gruseligen Beigeschmack. Wichtiger ist vielmehr, ob sie zufrieden damit sind. Und: was wir aus ihren Wünschen und Sorgen vielleicht noch lernen können.
Die vier Staffeln der Serie »Sex Education« sind auf Netflix verfügbar. »Ich fühl’s nicht« von Liv Strömquist ist in deutscher Übersetzung beim Avant-Verlag erschienen. »Agonie des Eros« von Byung-Chul Han wurde von Matthes & Seitz veröffentlicht.
