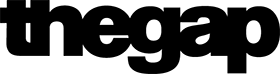Vieles ist besser, aber nichts ist gut: so könnte man die Lage pessimistisch zusammenfassen. Denn während ein Teil der queeren Community sich homonormativ eingliedert, wird ein anderer zum gesellschaftlichen Sündenbock gemacht.

Der Song Contest ist nicht das einzige Thema, das mich beschäftigt, versprochen! Aber als Andi Knoll während der Übertragung dieses Jahr mehrfach darauf hingewiesen hat, dass der Sieg von Conchita nun bereits zehn Jahre her ist – und sie dann auch noch zum großen Finale für ein Cover von »Waterloo« mit auf die Bühne in Malmö durfte – konnte ich nicht umhin, in Erinnerungen zu schwelgen. Denn auch wenn 2014 jetzt nicht sooo lange zurückzuliegen scheint – zumindest aus Sicht dieses Millennials –, die Welt und Österreich waren damals in vielerlei Hinsicht eine gänzlich andere. Eine markante Veränderung, die dabei direkt mit Conchita in Zusammenhang steht, ist die Sichtbarkeit von LGBTQIA*-Menschen und -Themen im Mainstream.
Vor einem Jahrzehnt gab es keine Ampelpärchen, keine Regenbogenzebrastreifen und auch keine gleichgeschlechtliche Ehe. Nicht einmal Mr. Song Contest war damals öffentlich out. Stattdessen gab es schräge Blicke, Unverständnis und Anfeindungen. Nicht, dass es all dies heute nicht auch gäbe, aber die Lage hat sich doch merklich verbessert. Von Neopronomen, trans Menschen und Dragqueens war damals in Österreich kaum die Rede. Ich erinnere mich noch gut, wie oft ich Freund*innen und Familie aus gegebenem Anlass erklären musste, was es eigentlich mit dieser bärtigen Gestalt in Frauenkleidern auf sich hat. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Sagt man da sie oder er?
Schluss mit Kopf im Sand
Conchita ist sicher nicht hauptverantwortlich für alles, was die queere Szene erreicht hat. Das Lob muss den unzähligen Aktivist*innen und engagierten Menschen, die teilweise über Jahrzehnte gegen Windmühlen gekämpft haben, gelten. Aber der Einfluss von Conchita auf den öffentlichen Diskurs sollte nicht unterschätzt werden. Alleine schon, dass plötzlich Fragen zu queeren Themen im Raum standen, dass am vielbeschworenen Wirtshaustisch über den Buchstabensalat diskutiert wurde, hat Denkprozesse angestoßen, hat es unmöglich gemacht, queere Menschen und ihre Forderungen weiter zu ignorieren.
Doch wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die sie nicht ignorieren kann, die aber gleichzeitig – pun intended – quer zu ihr stehen? Die sich nicht nahtlos eingliedern lassen in ein System, das auf heterosexuelle Kernfamilien ausgelegt ist? Frei nach dem Motto »Was nicht passt, wird passend gemacht« lautet eine gängige Antwort: Homonormativität, also die Eingliederung von queeren Lebensformen in ebendiese Heterostrukturen. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist eines der prominentesten Beispiele dafür. Frei vom Zwang, ihre Beziehungen immer auf das Ziel monogame Dauerbeziehung mit zwei-Komma-vier Kindern auszurichten hat sich eine Vielfalt an queeren Lebensentwürfen entwickelt, die fundamental infrage stellt, inwiefern es die Ehe als staatlich gestützte Idealform tatsächlich braucht. Mit der Forderung nach gleichgeschlechtlicher Ehe geht die Forderung einher, die Vorherrschaft dieser restriktiven Beziehungsform zu erhalten und auch für queere Menschen zum anzustrebenden Ziel zu erheben.
Homonormative Forderungen kommen dabei nicht selten aus der Szene selbst. Der Druck, nach etablierten gesellschaftlichen Normen zu leben, nicht anzuecken, sich einzuordnen – und die damit einhergehende Hoffnung, nicht mehr diskriminiert zu werden, keine Gewalt mehr zu erfahren, endlich auch »normal« zu sein – ist immens und nur allzu verständlich. Doch es ist eine trügerische Hoffnung, denn sie ist nicht darin begründet, dass Unterschiede bedingungslos anerkannt werden, dass Diversität an und für sich wertgeschätzt wird. Stattdessen ist der Grad an gesellschaftlicher Akzeptanz davon abhängig, wie passend die jeweilige Person und das jeweilige Leben gemacht werden können.
Sündenbock trans Community
Und was passiert mit Menschen, die sich partout nicht eingliedern lassen, deren Lebensrealitäten einen permanenten Affront gegen den grundkonservativen Status quo darstellen? Sie werden zu Zielscheiben, an ihnen entlädt sich die gesellschaftliche Spannung als Stellvertreter*innen für das Gros der queeren Community. Aktueller case in point: trans Menschen. Eine Bevölkerungsgruppe wird hier von rechten Agitateur*innen instrumentalisiert, um das in einer breiteren Bevölkerung schwelende Unbehagen gegen jene auszunutzen, deren Körper, Leben und schiere Existenz die eingefahrenen Denkmuster infrage stellt.
Deswegen braucht es mehr als Homonormativität, mehr als nur Akzeptanz. Es braucht eine grundlegende Änderung der Strukturen. Als queere Community dürfen wir uns nicht mit Krümeln abspeisen lassen, wir dürfen uns nicht zurückziehen auf faule biologistische Argumente. Es muss egal sein, ob wir schwul, lesbisch, bisexuell, trans, nichtbinär, asexuell oder anderweitig »abnormal« geboren werden. Die Normalität selbst ist das Problem, nicht, dass wir von ihr abweichen. Wir sollten mit Stolz queer sein, mit Stolz abnormal sein, mit Stolz pervers sein. Erstens, weil sonst jene unter uns leiden, die eigentlich den meisten Schutz benötigen. Und zweitens, weil wir es nur so schaffen können, tatsächlich eine Alternative zu einer Gesellschaftsform anzubieten, die uns letztendlich allen schadet – pervers oder nicht.

Am Samstag, 8. Juni um 12:00 startet die Vienna Pride Parade … ähm … die Wiener Regenbogenparade. Remember kids: the first pride was a riot!