Streaming hat nicht nur unseren Musikkonsum verändert, sondern beeinflusst auch maßgeblich das (Über-)Leben von Musiker*innen. So festgefahren diese neuen Strukturen bereits scheinen, möchten sie doch hinterfragt werden. Ganz nach dem britischen Songwriter und Producer James Blake: »Wollt ihr gute Musik oder das, wofür ihr bezahlt habt? Wenn wir hochwertige Musik wollen, muss jemand dafür bezahlen.«
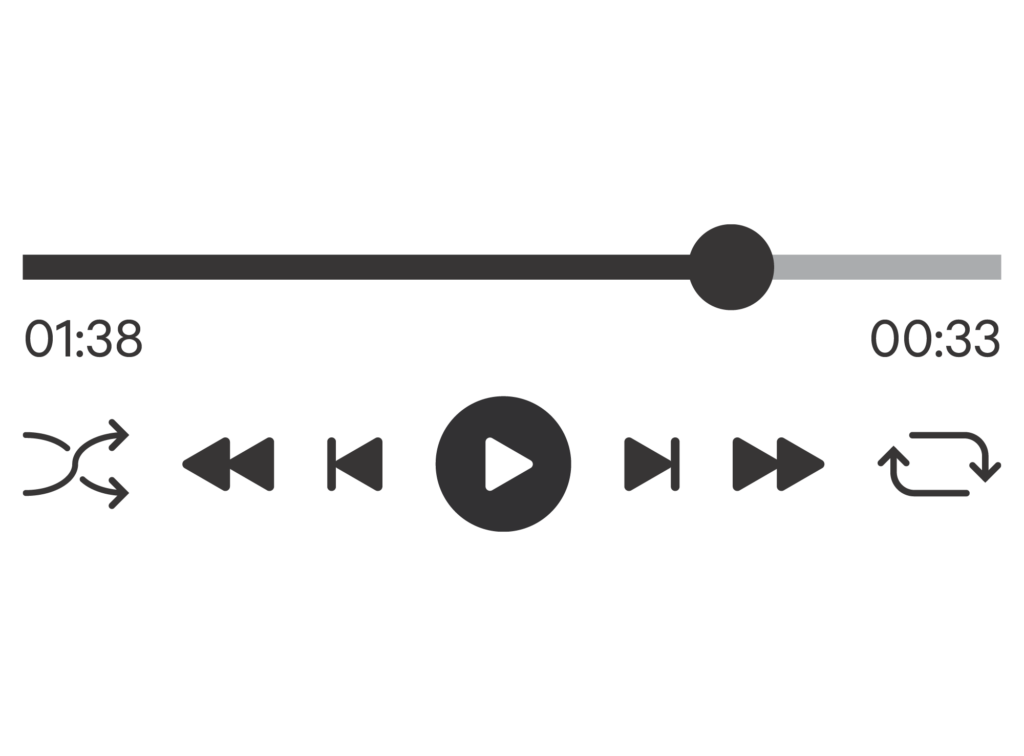
Der Jahresrückblick der Streamingdienste – gleich ob Wrapped oder Replay – liegt schon wieder eine Zeit zurück. Bei mir trafen sich diesmal Charli XCX, Mark Lanegan und Amyl and the Sniffers in den Top-Platzierungen. Ein kleines Fenster ins eigene Hörverhalten, das immer mit etwas Selbstüberwachung verbunden ist. Der Philosoph Michel Foucault hätte seine Freude mit diesen farbenfrohen Datenbündeln gehabt. Stichwort: Panoptikum.
Doch ungeachtet dieses jährlichen Rituals gab es zuletzt eine wichtige Neuerung in der Streamingwelt – verbunden mit einem viel zu kleinen Aufbegehren: das Konzept der »Streamshares«. Davor konnten Künstler*innen nämlich mit einem Betrag irgendwo zwischen 0,002 und 0,01 Cent pro Play rechnen. Lächerlich wenig angesichts dreistelliger Millionenumsätze der Anbieter*innen sowie der Tatsache, dass die Auszahlungen meistens noch mit Label und/oder Produzent*innen geteilt werden müssen. Doch dank Streamshares fließt das Geld nun in einen großen Topf, aus dem nach dem Anteil an den Gesamtstreams ausgezahlt wird. Nicht nur für recherchierende Journalist*innen ist das nun schwieriger nachzuvollziehen.
Die aus Linz stammende Newcomerin Kleinabaoho hat 2023 ihren ersten Song veröffentlicht. Im Gespräch, erzählt sie, dass sie das Streaminggeld bisher gar nicht zähle: »Kleine Acts sind abhängig davon, eine Plattform zu haben, wo sie irgendwie gefunden werden können. Manchmal denke ich dann, dass ich meine Musik so wenigstens überhaupt präsentieren kann. Aber das ist eine unfaire Besser-als-nix-Mentalität.«
Unter 1.000 Streams innerhalb von einem Jahr gibt es bei Spotify übrigens gar kein Geld. Die Aussage, ob gewollt oder nicht: Deine Musik ist unter dieser Hörer*innenzahl nichts wert.
Die Non-Profit-Organisation Recording Fund bewog diese Neuerung zu einer dramatischen Aussage: »Spotify ist jetzt im Endeffekt Richter, Jury und Henker von Musik.« Was früher hauptsächlich Gatekeeper wie Radiosender und Redakteure (das gendere ich mal absichtlich nicht) waren, ist heute der ominöse Algorithmus der Streamingdienste, den anscheinend niemand wirklich versteht – egal, ob Künstler*in oder Hörer*in. Mit Absicht, so die Autor*innen des Buchs »Spotify Teardown«, denn dahinter stehe ein Eigeninteresse. Die uneinsichtige »Blackbox« halte Machtverhältnisse aufrecht: Wer nicht weiß, wie es funktioniert, tut sich auch schwer, es zu kritisieren.
Gleichzeitig wird durch einzelne Erfolgsgeschichten das Narrativ vom American Dream am Laufen gehalten. Wenn es immer wieder ein paar wenige Glückliche gibt, kann man sie als Beweis verkaufen, dass das gesamte System ja doch funktioniere. Damit spielt auch der Außenauftritt vieler Streamingservices, die sich gerne als wohlwollende Mäzen*innen präsentieren.

Leave Me Alone, Taylor!
Nicht nur das Leben von Künstler*innen hat sich durch Streaming verändert, auch wir haben unser Hörverhalten schon längst dem steigenden Angebot angepasst. Durch Apps wie Tiktok werden beliebte Songs kürzer, verzichten auf Intro und Outro, setzen dafür aber auf häufige Wiederholung. Letzteres gilt auch für die Empfehlungen des Algorithmus: Egal, wie oft ich Taylor Swift noch wegklicke, sie lässt mich einfach nicht in Ruhe.
Rebecca Nicholson zieht in ihrem Artikel »Haben wir langsam alle den gleichen Musikgeschmack?« in der deutschen Wochenzeitung Der Freitag ähnliche Schlüsse: »Seltsamerweise erleben wir eine immer gleichförmigere Musiklandschaft, in der der Geschmack in einer Feedbackschleife gefangen ist, die der Algorithmus selbst geschaffen hat.« Bestätigt wird diese Annahme von der der Studie »Does Spotify Create Attachment?«. In dieser wurde festgestellt, dass Musik, die Menschen über algorithmisch generierte Playlists hören, bei ihnen kaum einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Selbst wenn diese bekennende Musikfans sind. Es fehle der Kontext zur Musik, Songs würden eher beiläufig konsumiert, als auf bedeutsame Weise wahrgenommen zu werden, lautet eine Schlussfolgerung. Was sich letztlich gerade auf Musiker*innen negativ auswirkt, die auf involvierte Fans angewiesen sind. Der Mythos, dass man über Playlists und Streaming entdeckt werden könne, scheint damit teilweise widerlegt.
Gewonnen oder gekauft?
Wer keine Lust auf unsichere Ergebnisse (und genug Budget) hat, kauft sich laut Recherchen von Investigativjournalist*innen des Y-Kollektivs sowieso einfach Plays. Ein anonymer Interviewpartner behauptet, die damals fünf erfolgreichsten Rapper so in die Charts gepusht zu haben. Das sei total verbreitet und einfach, erklärt er: »Auch wenn sie (Anm.: die Künstler*innen) selbst es nicht wissen, ihre Manager wissen es.« Das sei nicht nur unethisch und verzerre Charts, so das Resümee der Reportage, sondern es berge auch Gefahren wie Geldwäsche.
Warum aber Zahlen faken, wenn es ohnehin kaum Bezahlung dafür gibt? Kleinabaoho kennt das Phänomen und habe selbst schon fragwürdige Angebote ausgeschlagen. Dennoch verstehe sie die Motivation dahinter: »Auch wenn man es nicht wahrhaben will, sind Zahlen vor allem für den Industrieteil der Musik wichtig. Du hättest mich vielleicht nicht zum Interview eingeladen, wenn ich nur 300 Hörer*innen hätte. Man vergleicht sich leider auch untereinander anhand von Streamingzahlen. Dabei bringt das gar nichts, denn Fake Hörer*innen kommen zu keinem Konzert.«
Liebe zum Detail
Dass wir heutzutage für wenige Euros im Monat uneingeschränkt Musik hören können, hat seine Vorteile. Und dennoch zerstört die Nachfrage nach diesem Angebot das Produkt selbst – vor allem Independent-Projekte, die auf langfristige Entwicklung setzen. Jamal Hachem von Affine Records wünscht sich im Interview mit der Organisation Music Austria einen neuen Kollektivismus, um sich von großen Streamingmonopolen zu emanzipieren. Ein Lösungsvorschlag, der utopisch klingt, aber vielleicht nicht unmöglich wäre.
In der Arte-Doku »Wie Streaming die Musik auffraß« heißt es, dass wir seit Erfindung des MP3-Formats und damit verbundener Musikdistribution (ob legal oder illegal) in einer »Ära des Überflusses« leben, im Kontrast zur vorherigen »Ära der Raritäten«. Selbst vergriffene alte Platten findet man oft digital auf Apple Music & Co. Dabei hätten doch vor allem wir Hipster so gerne wieder Raritäten – ob alte Designermöbel, Echtlederboots oder eben eine Plattensammlung. Ein Vorschlag: gerne Lana-Del-Rey- oder Bilderbuch-Alben auf High-End-Vinyl kaufen, aber dann trotzdem auch mal ein wirklich rares Kunstwerk erstehen. Nämlich die Arbeit von kleinen lokalen Musiker*innen, deren Herz in diesen 500 Kopien steckt und deren Konzert letzte Woche doch eigentlich cool war. Dann kann ich auch versprechen, dass das eigene Wohnzimmerregal aussehen wird wie kein anderes. Und wenn das Geld dafür zu knapp ist, zählt ein Mixtape – notfalls auch digital – noch immer zu den romantischsten Gesten, die es gibt. Da sind Kleinabaoho und ich uns einig. Eine musikalische Reise, die ganz ohne Algorithmus auskommt.
Kleinabaoho hat letztes Jahr ihre Debüt-EP »Bilder« veröffentlicht. Kürzlich kam ihr neuester Song »Verlierer« heraus. Viele lokale Künstler*innen verkaufen physische Tonträger auf ihren Konzerten oder über Anbieter wie Bandcamp.
Dieser Text ist im Rahmen des The-Gap-Nachwuchspreises für Musikjournalismus in Kooperation mit dem Festival Waves Vienna entstanden.
