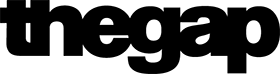Europa, ein Kontinent geprägt von Grenzen und Migration. Während die Geschichte Europas in einem Geflecht aus Mythen und Realitäten liegt, steht die gegenwärtige Debatte über Migration im Zentrum politischer und sozialer Auseinandersetzungen. Dieser Konflikt fordert Menschenleben, verwandelt Menschen in Migrant*innen, Soldat*innen in Täter*innen und Zivilist*innen in humanitäre Helfer*innen.
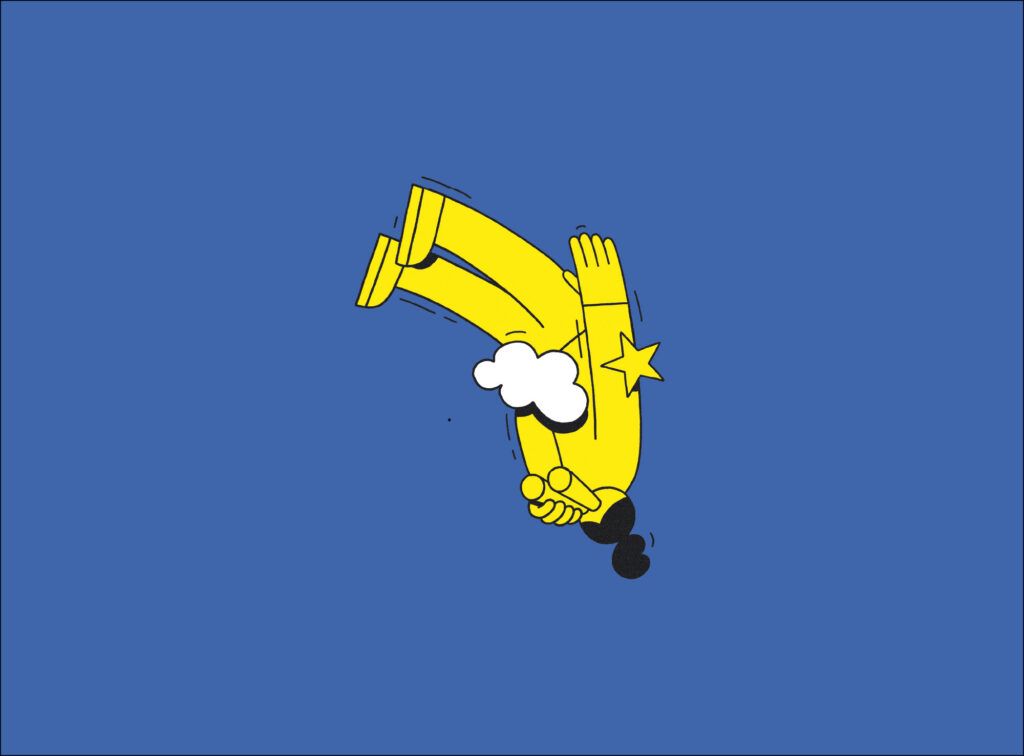
Eine phönizische Prinzessin wird von Göttervater Zeus verzaubert, der ihr in der Gestalt eines Stieres erscheint und sie mit sich auf die offene See reißt – weg vom Festland und auf eine kleine Insel. Der Name der Prinzessin: Europa. Die romantisierte Entstehungsgeschichte eines Kontinents, der aus Mangel an gemeinsamer Identität auf alte Mythen zurückgreift. Will man diese Geschichte einer Neuinterpretation unterziehen, so wäre die Prinzessin ein Flüchtlingsmädchen aus Syrien oder dem Libanon, das von einem Schlepper anstatt von einem weißen Stier aufs offene Mittelmeer gebracht wird. Falls unsere Prinzessin wieder festen Boden unter den Füßen bekommt, wäre sie in diesem Fall nicht auf Kreta, sondern höchstwahrscheinlich in Moria gelandet. Zu hoffen ist, dass unserer Europa dann nicht dasselbe Schicksal widerfährt wie so vielen Prinzessinnen, die Zeus gefallen haben.
Vom Menschen zur Migrant*in
Migration war schon immer ein Kernthema Europas und ein Problemthema der EU. Völkerwanderungen und Handelsrouten haben seit jeher sichergestellt, dass Europa kein homogener Ort sein kann. Dass ein Mensch formell Immigrant*in werden kann, ist jedoch eine Erfindung der Nationalstaaten. Indem man Grenzen errichtet und definiert, wer Inländer*in ist, erfindet man auch die Ausländer*innen. Um eine gemeinsame Identität zu schaffen, wo früher vielfältige Leben stattfanden, muss man nicht nur definieren, was »wir« sind, sondern auch, was die »anderen« sind. Migrant*innen sind weniger Menschen und vielmehr eine Sammlung von Regeln, Situationen und Adjektiven. Eine deutsche Frau, die für ihr Studium nach Krems gezogen ist, teilt sich dieselbe Migrant*innendefinition mit unserer phönizischen Prinzessin: eine Person, die sich länger als ein Jahr außerhalb des Staates aufhält, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. Rein rechtlich bleibt die Deutsche aber natürlich ein Mensch, der arbeitet, studiert, reist und wohnt. Die Prinzessin wird durch die Einreise zu einer Migrantin, über die entschieden werden muss. Darüber, wo sie arbeitet und wo sie wohnt, ob und wohin sie reisen darf und falls sie in der Heimat studiert hat, ob das überhaupt gut genug für uns ist.
Die Diskrepanz zwischen Fakten und Wahrnehmung bei Fluchtthemen wird oft durch Medienberichte verstärkt. Im vergangenen Jahr kamen laut Migrationsforscher Gerald Knaus so viele Menschen aus Afrika mit Booten in die EU wie im Jahr 2022 Ukrainer*innen an anderthalb Tagen nach Polen. Von einer »Flut an Flüchtlingen« wird aber bei jenen gesprochen, die über das Mittelmeer kommen. Dabei werden die meisten Flüchtlinge nicht von Europa, sondern von Nachbarländern in Afrika oder Asien aufgenommen. Dominik Bartsch, UNHCR-Repräsentant in Deutschland, betont: »Die Flüchtlingskrise findet woanders statt, in Ländern wie Libanon, Bangladesch oder Uganda. In Europa besteht lediglich eine Krise der Solidarität.«
Europas Kolonialerbe
Die häufige Frage, ob Europa sich leisten könne, Menschen auf der Flucht aufzunehmen, scheint insbesondere unüberlegt, wenn man bedenkt, was diese überhaupt erst zur Flucht zwingt: nämlich wie viele Konflikte, Bürgerkriege, Hungersnöte und repressive Regime ihre Wurzeln im europäischen Imperialismus haben. In Europa profitiert man bis heute von den Erträgen des Kolonialismus, der Rohstoffe und Menschen als Ressourcen im industriellen Aufstieg verheizt hat. Wer sich der 500-jährigen Ausbeutungsgeschichte Europas und (neo)kolonialer Praktiken bewusst ist, sollte noch einmal reflektieren, welche Fragen im Kontext um Flucht und Aufnahme legitim sind.
Inmitten dieser Diskussionen und der historischen Kontextualisierung von Migration und Flucht, formen sich die verschiedenen Routen, auf denen Menschen nach Europa gelangen. Eine der drei großen Hauptrouten ist die Balkanroute. Diese Route, geprägt von Unsicherheit und Leid, wurde in den Medien wegen inhumanen Lagern wie in Bihać und den aggressiven Pushbacks an den Grenzen bekannt. Petar Rosandić, Aktivist und Mitbegründer des Vereins SOS Balkanroute, auch bekannt als Rapper Kid Pex, beschreibt die Zustände an den Grenzen als einen »de facto rechtsfreien Raum«. Er schildert Vorfälle, bei denen Pushbacks so aggressiv durchgeführt werden, dass Menschen teilweise schwer verletzt gezwungen sind, den bis zu 70 Kilometer langen Weg zurück ins letzte Lager anzutreten. In manchen Situationen werden den Betroffenen sämtliche Wertgegenstände oder sogar ihre Kleidung abgenommen.
Berufliche Deformation
Diese Vorfälle ereignen sich auch an Grenzübergängen, an denen österreichische Polizist*innen im Einsatz sind. Rosandić äußert seine Besorgnis darüber, dass das Verhalten Europas wie ein Bumerang wirken könnte. Flüchtende Menschen würden durch die erlebte Aggression an den Grenzen zusätzlich traumatisiert und die Polizist*innen, die dort in den Einsatz geschickt werden, seien gezwungen in einem rechtsfreien Raum zu agieren. Dies könne zu einer beruflichen Deformation führen, die sich auch auf ihre Arbeit in Österreich auswirke. Pushbacks und die Situationen in Lagern entlang der Balkanroute betrachtet Rosandić eindeutig als Abschreckungskampagne. Seine Antwort auf die Frage, was schieflaufe: »Der Irrtum besteht darin, dass wir unseren Reichtum so vehement verteidigen, dass wir Menschen abschrecken, die sowieso keine andere Wahl haben.«
Die Forderung nach völlig offenen Grenzen unterstützt der Aktivist nicht, er ist der Meinung, dass Humanität und Ordnung in Einklang gebracht werden können und müssen. Legale Fluchtwege sieht er als Schritt in die richtige Richtung. Theoretisch hat Europa klare humanitäre Regelungen festgelegt, wie mit Menschen auf der Flucht umgegangen werden soll, doch die Praxis weist in eine völlig andere Richtung. Denn für viele Menschen markiert die österreichische Grenze das Ende ihrer Fluchtroute. Ein ehemaliger Grundwehrdiener, der 2022 einen Monat lang dort stationiert war, berichtet uns: »Die Soldaten betrachteten das Ganze als eine Jagd, als das Game.« Eine erschreckende Bezeichnung, die es auf beiden Seiten gibt, wie Rosandić weiß. Für die Fliehenden ist das Spiel geleitet vom Wunsch, über die Grenze zu gelangen, wohingegen auf Seiten der Soldaten jene Einheit »das Game« gewinnt, die die meisten Menschen »eingefangen« hat.
Während in der mythischen Entstehungsgeschichte Europa also diejenige ist, die eine neue Heimat finden musste, agiert das reale Europa mehr wie Zeus, der ihr empathielos seinen egoistischen Willen aufzwingt. Es ist eine erschreckende Geisteshaltung, von der man Abstand nehmen muss. Nur so lässt sich eine Balance finden zwischen den pragmatischen Erfordernissen von Sicherheit und den moralisch-humanitären Verpflichtungen jenen gegenüber, die aus Not zu uns kommen.
Organisationen wie SOS Balkanroute bieten nicht nur humanitäre Hilfe, sondern dokumentieren auch die Vielfalt menschlicher Erfahrungen und Schicksale, die sich hinter den politischen Debatten und Statistiken verbergen.