Zehn Jahre sind entweder sehr lange oder sehr kurz. Wenn es um eine popkulturelle Analyse geht: unfassbar lang. Um eine erschöpfende Einordnung aller relevanten Erscheinungen und Geschehnisse zu liefern, hätten wir einen mindestens 2010-seitigen Sammelband herausgeben müssen. Stattdessen wollen wir in unserem Dossier eine feine Auswahl an Themen bearbeiten, die das vergangene Jahrzehnt genauso wie uns geprägt haben. Illustriert wurden alle Texte von Lisa Schrofner. Wo warst du, als die 2010er vorbei waren?
Forever a Mood – Anxiety in der Popmusik
von Theresa Ziegler
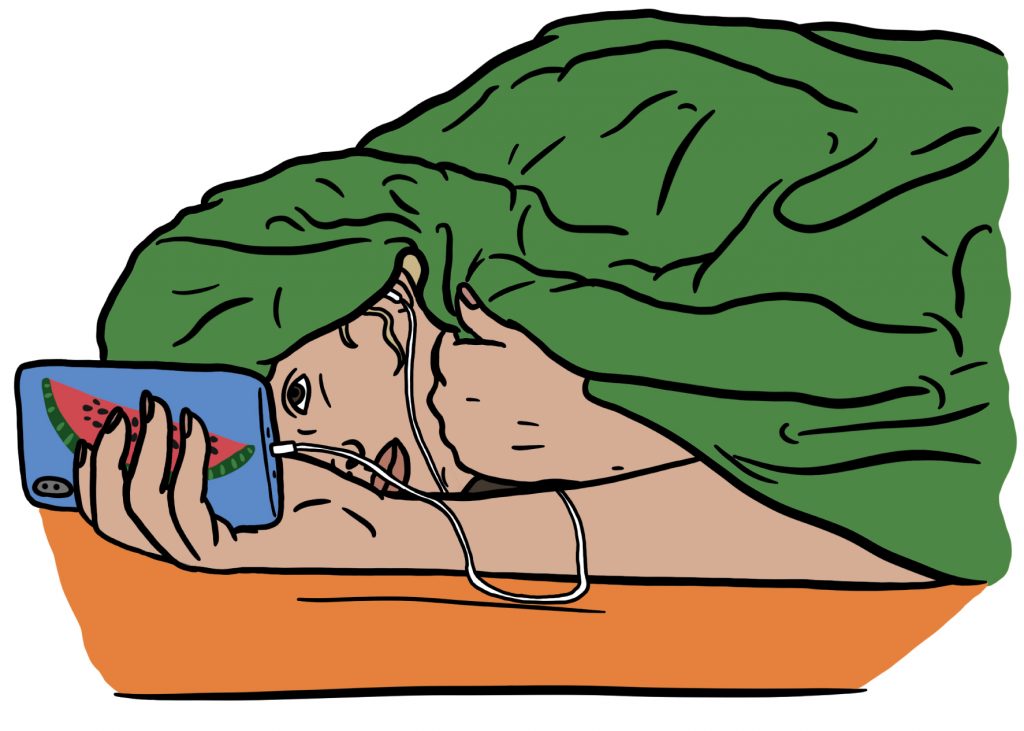
Die 2010er haben happy begonnen. Einserseits: der EDM-typische Build-up und Drop. Andererseits: eine ganz eigene musikalische Stimmung unter dem konzeptuellen Begriff New Maximalism. Beides mit dem Ziel, sich am Leben zu fühlen. Maximalismus beschreibt ein wiederkehrendes musikalisches Phänomen. In den frühen 2010er-Jahren bedeutet das, Hymnen zu schreiben, die uns berühren und vor allem empowern. Schmettert Kesha 2010 noch »We R Who We R«, fragt uns Katy Perry zeitgleich, ob wir uns je wie ein Plastiksackerl fühlen und ein Jahr darauf bestätigen Fun., dass wir heute Nacht jung sind. Etwa zur selben Zeit wie diese bedeutungsschwangeren Bretter macht sich auch der sogenannte »Millennial Whoop« breit – eine Melodiefolge zweier alternierender Stufen, auf die ein einfaches »Oh« oder »Uh« gesungen wird. Am Anfang des Jahrzehnts waren Social Media noch nett, sachliche politische Diskussionen manchmal noch möglich und lebensbejahende Woahs hie und da eben angebracht.
Es gibt keinen breiten Konsens darüber, was genau die kollektive Deflation in der Optimismus-Skala unserer Weltanschauung zum Kippen brachte. Grund gab es jedenfalls genug: Klima wird vom Wandel zur Krise zur Katastrophe, Diskriminierungen und Marginalisierungen endlich mehr wahrgenommen und solide Entscheidungen den eigenen Lebenslauf betreffend nahezu unmöglich. Millennials reagierten darauf mit Aktivismus, der sich gegenüber anderen historischen politischen Bewegungen aber mindestens in einem Punkt unterscheidet: die Anxiety. Ein Wort, das sich kaum ins Deutsche übersetzen lässt, doch das muss heute auch gar nicht mehr sein. Das Gefühl, die Welt und man selbst werden einem zu viel, die bloße Existenz zur unerfüllbaren Verantwortung.
Unumgänglich spiegelt sich so ein Generationengefühl in der Popmusik wider. Cloud-Rap gewinnt durch die gemeinsame Resignation und den Rückzug ins leere und übervolle Innenleben stark an Momentum. Bands wie The 1975 bauen ihre komplette musikalische Karriere auf einen Sound, der saisonale Depression verkörpert. Billie Eilish nuschelt sich mit Minimalbeat ganz am Ende des Jahrzehnts in einen globalen Hype. Auch in Österreich macht sich Anxiety-Ästhetik gut: Leyya vertonen das urgierende »Superego« und HVOB klingen immer wie kurz nach oder kurz vor einer akuten Panikattacke. Millennials haben sich damit abgefunden, dass ihr Mood für immer durch diese generalisierte Angst geprägt sein wird – und die Musik, die sie machen, wohl auch.
